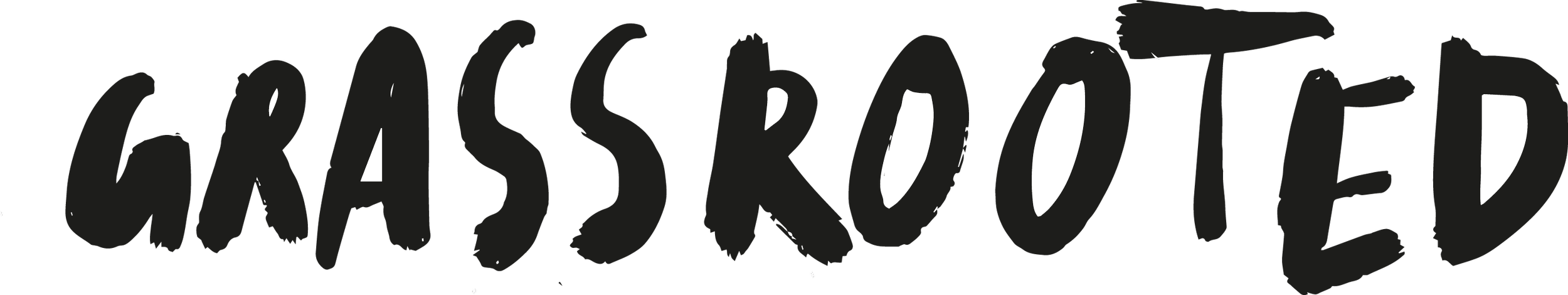Unsere Freund:innen haben sich in der dritten Ausgabe des ernteriif mit diesen pflanzlichen Proteinbomben beschäftigt und wir möchten die spannenden Inhalte dieses Heftes mit euch teilen!
Die Idee von ernteriif ist es mit Blick auf saisonale Erzeugnisse lokaler Landwirt:innen einen vertieften Einblick auf deren Arbeit und Produktionsweise zu verschaffen. Im Fokus stehen kleinstrukturierte Landwirtschaftsbetriebe, die grossen Wert auf Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit legen. Mit der Vision, dass wir Konsument:innen uns verstärkt mit der Herkunft unserer Lebensmittel und den Herausforderungen ihrer Herstellung auseinandersetzen.
Was sind eigentlich alles Hülsenfrüchte?
Hier ein kleiner Überblick über die beliebtesten Hülsenfrüchte, die du in der Schweiz kaufen kannst. Einige davon bieten wir in unserem Sortiment in der rampe21 an, vor allem solche, die auch lokal produziert werden.
Kichererbsen: Roh giftig. Können vielseitig gekocht werden: Geröstet als Nüsse, als Falafel, Hummus, Farinata und vieles mehr! Zu kaufen in der rampe21!
Diverse Bohnensorten (Mungo-, Feuer-, Garten-, Soja-, Auskernbohnen):
Soja und Auskernbohnen findest du bei uns im Laden.
Grüne- und Rote Linsen: Hoher Proteingehalt. Leichter verdaulich als Erbsen und Bohnen. Guter Fleischersatz. Gibts in der rampe21!
Weisse Lupine: Oft als als Tierfutterpflanze angebaut, aber kann auch z.B. zu Lupinenmehl oder Lupinenkaffee verarbeitet werden.
Erdnüsse: Etwas überraschend, aber ja, botanisch gesehen auch eine Hülsenfrucht. Dazu ein berühmtes Känguru-Zitat: “Ich möchte Sie nun in aller Form darauf hinweisen, dass es sich bei den sogenannten Erdnüssen keineswegs um Nüsse, sondern um Hülsenfrüchte handelt. Die Bezeichnung “Erdnüsse und andere Nüsse” ist also mehr als irreführend… Hallo?! Hallo?!”
Was enthalten Kichererbsen alles?
Sie sind reich an wertvollen Proteinen, haben viele Ballaststoffe, wenig Fett, sowie Mineralstoffe.
Wie werden sie hergestellt?
Kichererbsen werden maschinell geerntet. Das Erntegut besteht aus einer Mischung von Getreidekörnern bzw. Hülsenfrüchten, die in einem technisch aufwendigen Verfahren getrennt werden müssen. Die Kichererbsen werden getrocknet und vorgereinigt. Eine erneute Reinigung ist danach nötig: Denn trotz aller Sorgfalt kann es noch Steinchen oder Getreidekörner enthalten.
Zubereitung/Verwendung:
Kichererbsen mit fliessendem, kaltem Wasser spülen
über Nacht einweichen
am nächsten Tag Kichererbsen gut abspülen
mit frischem Wasser zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 60 min nicht zu weich garen
Salz, sowie säurehaltige Zutaten (Zitronensaft, Essig, Weisswein, etc.) erst nach dem Kochen beifügen. Je nach Rezept Nachquellen lassen.
Wie lange dauert die Zubereitung?
Sie sollte ca. 8 h in einem Verhältnis 1:3 in Wasser eingeweicht werden und danach ca. 60 min gekocht werden.
Infos zur Tradition und Geschichte der Hülsenfrüchte
Leguminosen sind in den unterschiedlichen Regionen der Welt schon lange Teil unseres Speiseplans. Die ersten Nachweise von verschiedenen Hülsenfrüchten finden sich in Äthiopien, in China, in Südostasien und Südamerika. Im klassischen Altertum der Ägypter, der Griechen und Römer hatten Linsen, Ackerbohnen und Erbsen einen hohen Stellenwert in der Ernährung. Aufgrund ihres Eiweissgehaltes weit über dem von Weizen, Hafer, Gerste und Reis, hatten Hülsenfrüchte schon früh die Proteinversorgung breiter Bevölkerungskreise übernommen. In Europa waren es traditionellerweise Erbsen, Bohnen und Linsen, die hier heute aber nicht mehr als Grundnahrungsmittel gelten.
Mit steigendem Wohlstand fanden immer mehr tierische Proteine wie Milch, Käse oder Fleisch den Weg auf unsere Teller. Die pflanzlichen Proteine wie Soja wurden als Tierfutter verwendet. Mit einem neuen Bewusstsein für Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung, bauen in den westlichen Wohlstandsgesellschaften wieder viele Menschen Körnerleguminosen als Alternative zu Tierprodukten in ihren Ernährungsplan ein.
Stickstoff in den Acker bringen dank Hülsenfrüchten
Knöllchenbakterien? Das sind spezielle Bakterien, die sich in einem gesunden Boden finden und mit denen Leguminosengewächse eine Symbiose eingehen. Die Pflanze versorgt die Bakterien mit mineralischen Nährstoffen und im Austausch dafür nimmt die Pflanze die stickstoffreichen Ausscheidungen der Knöllchenbakterien entgegen, die ihrerseits der Luft den Stickstoff entziehen können. Das ist vorteilhaft, da unsere Luft zu 78% aus Stickstoff besteht, dieser im Boden jedoch Mangelware ist und gleichzeitig einer der entscheidenden Wachstumstreiber der Pflanzen.
Auch für sonstige Bodennährstoffe und für Wasser bieten Leguminosenwurzeln ein gutes Aufschliessungsvermögen und werden deshalb oft auf steinigem und sandigen Boden gepflanzt.
Hülsenfrüchte sind also gesunde Energielieferantinnen, die auf sonst schwerer nutzbarem Boden gedeihen, und im allgemeinen eine wichtige Funktion bei der nachhaltigen Fruchtfolge einnehmen, da sie zugleich Ernte und Nährstofflieferant für den Boden sind.
Synthetischer Stickstoffdünger als Co2-Verursacher:
Im letzten Post konntet ihr erfahren, dass Leguminosen (Hülsenfrüchte) zugleich Ernte und Nährstofflieferant für den Boden sind, da sie Stickstoff aus der Luft in die Erde führen können. Seit der Industrialisierung der Landwirtschaft und der Verfügbarkeit von synthetischem Stickstoff wurde auf schweizer Äckern fast ausschliesslich mit synthetischem Stickstoffdünger nachgeholfen. Synthetischer Stickstoffdünger ist aber einer der grössten CO2 Verusacher in der Landwirtschaft!
Bis Ende des 20. Jahrhunderts waren die meisten Hülsenfrüchte auf den Feldern konventionell wirtschaftender Betriebe absent. Der Biolandbau, welcher nicht auf synthetische Dünger zurückgreifen kann, hat als Reaktion darauf die Einbindung von Hülsenfrüchten, wegen ihrer besonderen Fähigkeit, in die Fruchtfolge zur Bedingung gemacht. In der Schweiz schreibt das Reglement von Bio Suisse vor, dass eine Fruchtfolge mindestens 20 % bodenschützende und nährstoffanreichernde Kulturen aufweisen muss. So finden die Leguminosen immer mehr zurück auf schweizer Äcker!
Leguminosen finden den Weg zurück auf Schweizer Äcker - aber zumeist nur indirekt auf unsere Teller
Bis Ende der 2000er Jahre hatte die Schweiz einen sehr geringen Eigenversorgungsgrad an pflanzlichen Proteinen. Die Fruchtfolgen waren dominiert von Getreide und Mais. Ab 2008 starteten agrarische Forschungsinstitutionen und BIO SUISSE verschiedene Projekte zur Förderung der einheimischen Produktion von Körnerleguminosen. 2015 machten Soja, Ackerbohnen, Lupinen und Eiweisserbsen 2,5% der offenen Ackerfläche in der Schweiz aus, ein Anteil, der seither noch weiter angestiegen ist.
Jedoch ist ein Grossteil dieser Menge als Futtermittel in der Tierhaltung bestimmt. Es stammen zwar mehr als zwei Drittel der benötigten Eiweissmenge in der Schweizer Milch- und Fleischproduktion aus der inländischen Grasproduktion, der restliche Drittel des Tierfutters besteht aus Futterprotein (zu 63% aus Sojaprodukten bestehend) und wird zu einem grossen Teil importiert. Zur Veranschaulichung: Würden die 200.000 Tonnen Tierfutter in der Schweiz angebaut, würde dies drei Viertel der Schweizer Ackerfläche beanspruchen. Vor allem bei der Geflügelhaltung und Schweinemast führt kein Weg an importiertem Futter vorbei.
Anbau in der Schweiz
Insgesamt steigt zwar die Anbaufläche von Leguminosen in der Schweiz aber ein Grossteil wird als Tierfutter verwendet. Da aber beispielsweise Kühe hervorragende Verwerter von Gras sind, was der Mensch von sich schlecht behaupten kann, lässt sich Nutztieren das pflanzliche Eiweiss ohne schlechtes Gewissen streitig machen.
Soja wird in der Schweiz vorwiegend für die Tofuproduktion, also für die menschliche Ernährung, angepflanzt. Für die Tierfütterung wird meistens das viel billigere Soja aus der Donauregion in Osteuropa oder auch aus Brasilien importiert. Sojabohnen brauchen viel Wärme und deren Anbau verzögert sich bei schlechter Witterung schnell in den Frühherbst, was der Kultur gefährlich werden kann. Geeignete Anbauflächen für Speisesoja sind in der Schweiz daher beschränkt verfügbar. Da Soja in der Schweiz nicht heimisch ist, muss der Boden mit der Saat mit Knöllchenbakterien beimpft werden, weil die für die Symbiose mit de Sojapflanze benötigten Bakterien nicht in unseren Böden vorkommen.
Fruchtfolge
Linsen können, wie es Jorge Vasquez macht, gut als Mischkultur mit Leindotter oder Hafer angebaut werden. Dies erleichtert die Ernte, da die Linsen sich an die Partnerpflanzen halten können. Aus dem Leindotter kann als Nebenprodukt ein Öl gemacht werden, welches sich gut als Salatdressing verwenden lässt.
Der Anbau von Linsen bindet Stickstoff im Boden und hinterlässt ihn krümelig und gut zu bearbeiten.
Das Linsensaatgut kommt im März auf den Acker. Erntezeit ist im September. Danach müssen die Linsen getrocknet und gereinigt werden. Herausfordernd ist, dass keine Kieselsteine oder Erde zurückbleiben, denn diese können die selbe Grösse wie die Linsen haben.
Die Fruchtfolge des Betriebs soll einerseits die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen und die Fruchtbarkeit des Bodens auch für die nächste Generation sicherstellen. Bei der Wahl der Kultur muss beachtet werden, ob die Kultur einen grossen Nährstoffbedarf hat, ob allfällige Krankheiten oder Schädlinge bei der Vor- oder Nachkultur zu beachten sind und ob Fruchtfolgepausen eingehalten wurden.
📒✏️ Quelle: Die Infos, das Bild und der Texte stammen aus dem @ernteriif. Wir haben das Magazin in der rampe21 und ihr könnt gerne bei eurem nächsten Besuch eines mitnehmen!